Das aktuell erschienene Heft (52 Seiten) von Ortsheimatpfleger Hartmut Alder wird angeboten:
Der Verkauf erfolgt ab 22.09.2025 in der Alten Apotheke in Thiede, Frankfurter Straße, Kostenbeitrag 3,- Euro
Hinweis:
Wie ich heute erfahren habe, gibt es (noch?) keine Hefte in der Alten Apotheke.
Interessenten sollten sich direkt an den AK Thiede wenden: https://thiede.de/impressum
Tut mir leid, aber das in grün Geschriebene war wohl eine Fehlinformation? 😤
Das Vorwort zum Heft von Hartmut Alder:
 Die Gaststätten von Thiede-Steterburg
Die Gaststätten von Thiede-Steterburg
von Hartmut Alder
Früher waren sie der Mittelpunkt unseres Ortes, doch leider gehen seit Jahren in fast allen Gaststätten, Dorfschänken, Wirtshäusern, Kneipen oder Biergärten die Lichter für immer aus, und mit ihnen geht auch immer ein gutes altes Stück Tradition.
Zur Geschichte
Das größte und wichtigste Wirtshaus lag früher meist in der Nähe der Kirche, damit auch Fremde bei kirchlichen Zusammenkünften wie Taufen, Hochzeiten oder Beerdigungen dort einkehren konnten.
In größeren Ortschaften, und Thiede ist eine große Ortschaft, lagen noch weitere Gaststätten: z. B. für Fuhrleute entweder an der Hauptstraße oder an einem anderen zentralen Ort des Dorfes.
Der Sonntag war der Tag, an dem man sich vor der Kirche und im Gasthof zeigen konnte. Das Wirtshaus war zunächst einmal ein Ort der Entspannung und der Unterhaltung, des Politisierens und des Diskutierens, ein Treffpunkt nach der Arbeit, wo beispielsweise auch der Lustige und Witzige über seinen sozialen Stand hinaus geschätzt wurde.
Widerspruchslos und unangefochten behauptete jedoch jede Gruppe des Dorfes ihren angestammten Platz des Dorfgasthauses. So hatten die Großbauern ihren besonderen Tisch und das „gute” Geschirr. Die Halbbauern saßen wiederum gesondert und hatten glatte, einfache Gläser. Und in der anderen Ecke der Wirtsstube stand ein Tisch für die Kleinbauern, die ihr Bier meist aus gerippten Gläsern tranken. Das Wirtshaus war auch Keimzelle vieler Vereine.
In den Nebenzimmern konnten sich Mitglieder der unterschiedlichsten Vereine treffen. Gasthäuser waren neben der Kirche und der Schule oftmals die einzigen „öffentlichen” Gebäude in denen Zusammenkünfte stattfinden konnten. So gab es beispielsweise in Thiede Ende des 19. Jahrhunderts den Sportverein, den Männer-Gesangsverein, den Landwehrverein und die Freiwillige Feuerwehr.
Es waren aber nicht nur die Bauern, die sich in diesen Vereinen trafen, sondern auch die sogenannte „Intelligenzschicht” bestehend aus Pfarrer, Lehrern, Kaufleuten, Apotheker und Handwerkern. Diese waren gern gesehene Mitglieder in den Vereinen und auch meist bei den Gründungsmitgliedern der Vereine zu finden.
Sinn und Zweck der Vereine war, die Gemeinschaft des Dorfes zu stärken. Feste und Feierlichkeiten förderten dies.
Im Gasthaus gemeinsam essen, trinken und tanzen, gemeinsam lachen aber auch marschieren, vor allem jedoch singen, waren wichtige Elemente der Schaffung von Gruppenbewusstsein sowohl bei Hochzeitsfeiern, Erntedankfesten, Faschingsfeiern oder politischen Nationalfesten.
Alltag und Kultur auf dem Lande und speziell in unserem Ort haben sich spätestens seit 1950 grundlegend geändert, so auch die Gasthauskultur.
1955 arbeiteten immer weniger Bewohner unseres Ortes als oder beim Bauern. Viele verdienten ihr Brot in Braunschweig in den großen Firmen. Die neuen Techniken in den Fabriken führten zu großen Arbeitserleichterungen. Körperlich schwere Arbeiten wie sie noch im 19. Jahrhundert die Regel waren und damit den Körper auszehrten, so dass Freizeitaktivitäten so gut wie nicht möglich waren, nahmen immer mehr ab. Der Alltag in unserem Dorfe war nunmehr dadurch bestimmt, dass zumindest die nicht-bäuerliche Bevölkerung nicht mehr an den jahreszeitlichen Arbeiten wie Säen oder Ernten gebunden waren. Schichtarbeit oder die 48-Stunden-Woche führten zu einem anderen Freizeitverhalten. Veranstaltungen konnten nun auch abends oder unter der Woche stattfinden. (Kino, Theater etc.)
Auch kam das neue Medium Fernsehen dazu. Statt zum Männerstammtisch zu gehen, hockte man mit Familie und Schnittchen zu Hause auf dem Sofa. Ab 1965 kam eine größere Mobilität dazu: das Auto, welches sich immer mehr Familien leisten konnten. Jetzt wurden Gaststätten außerhalb des Dorfes aufgesucht, beispielsweise im Harz oder in der Heide. So verschwanden in den 1960/1970er Jahren die örtlichen Strukturen, die das kulturelle Leben beeinflusst haben.
Zählte man 1960 noch 30 Gaststätten in Thiede-Steterburg, so sind es heute nur noch wenige, die die Gastlichkeit aufrechterhalten.
Die Zeiten ändern sich, damit gehen viele Veränderungen einher, auch in unserer Gesellschaft. Vor allem für viele jüngere Leute (Familien) hat das klassische Wirtshaus seine Anziehungskraft verloren. Viele gönnen sich gern ein schickes Essen im Restaurant, lassen sich ihr Essen frei Haus liefern oder es sich beim Hotelaufenthalt gut gehen.
Sehen und gesehen werden lautet heute die Devise!
Gasthäuser hatten und haben es zunehmend schwerer. Bierzapfen allein reicht nicht mehr aus. Ähnlich wie Vorlieben beim Essen und Trinken haben sich auch die Ausgehgewohnheiten und die Kommunikation gewandelt. Viele interessieren sich mehr für die neuesten You-Tube-Kanäle denn für Skat oder Schafkopf. Statt eines Bieres in der schummrigen Kneipe genießen sie Cocktails in einer schicken Bar in der Stadt oder einen Latte-Macchiato im Cafe.
Aber auch die Wirtsleute selbst haben starke Nachwuchsprobleme. Oft finden sie niemanden, der sie am Zapfhahn oder in der Küche ablösen will, wenn der Ruhestand naht. Lange Arbeitszeiten auch an den Wochenenden, teils mit schmalem Verdienst, wirken wenig verlockend auf die jüngere Generation. Geht ein „alter Wirt”, ist oft Leerstand die Folge.
Ein weiterer Punkt ist die in die Jahre gekommene Ausstattung. Viele Lokale waren oder sind in alten Fachwerkhäusern, diese müssen früher oder später renoviert werden. Die Lokale wurden mit der Zeit immer leerer, nicht nur die Gäste blieben aus, sondern auch Spielautomaten, Billiard-Tische und Musikboxen verschwanden. Es wurden Abgaben fällig wie Vergnügungssteuer und Gema. Auch die Brauereien haben bei Fassbier kräftig zugeschlagen. Das Bier aus dem Supermarkt ist deutlich günstiger -also wozu in die Kneipe gehen?
Ein Problem im ländlichen Gebiet, das sich über die Jahre verschlimmert hat: „Es wird immer teurer”, die Branche stöhnt vor allem über, aus ihrer Sicht, -überbordende Bürokratie und Regularien.
Nicht nur dass 2007 das Rauchen in Gaststätten verboten wurde, es muss auch der Mindestlohn gezahlt werden. Ferner gilt die Dokumentationspflicht zur Kennzeichnung der Allergene bis hin zu Brandschutz, Lebensmittel- und Hygienevorschriften mit vielfachen Schulungen, bei denen der Gastwirt ständig auf dem Laufenden sein muss.
Ein kluger Mann sagte mal: „Wo die Wirtschaft stirbt, stirbt auch bald der Ort.”
Nun so schwarz will ich die Zukunft nicht sehen.
Hartmut Alder - Ortsheimatpfleger




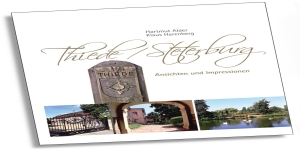


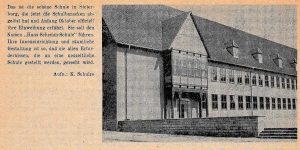










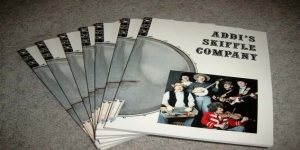
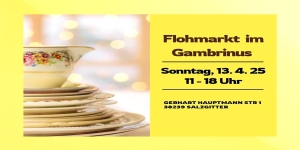

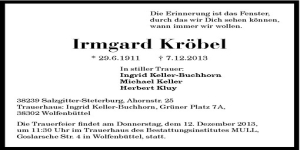


Kommentar schreiben